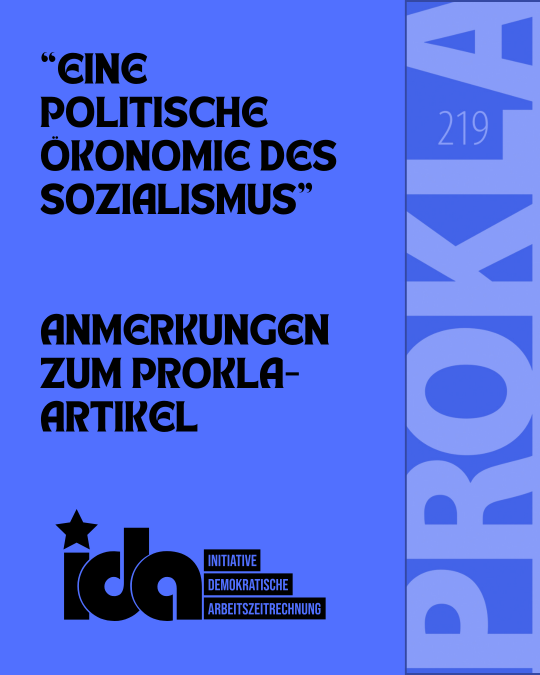Dies ist ein Gastbeitrag von Hermann Lueer. Der Beitrag nimmt Bezug auf unseren Prokla-Artikel vom 02.06.2025. Gastbeiträge spiegeln nicht unbedingt die Position von IDA wider. Wir freuen uns jederzeit über die Einreichung von Gastbeiträgen zum Thema Arbeitszeitrechnung zur Veröffentlichung.
1. Die Rolle der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit
Auf Seite 396 beginnt ihr mit den selbstverwalteten Betrieben und deren Arbeitszeitkalkulation.
„die selbstverwalteten Betriebe besitzen auch die Initiative und weitgehende Autonomie bei der Erstellung ihrer Pläne. … Die im Plan (hier ist die Rede von einzelnen Betriebsplänen) erfasste Gesamtstundenzahl kann dann durch die Anzahl der im Plan veranschlagten Produktmenge dividiert werden, wodurch sich ein Leistungsaufwand pro Produkt in Stunden ergibt. Dieser bildet den Abgabewert des Produkts.“ (S. 396)
Das stimmt nicht, wie ihr selbst auf Seite 397 schreibt:
„Nicht die individuelle Arbeitszeit bestimmt den Abgabewert der Produkte, sondern die kooperativ ermittelte gesellschaftliche Durchschnittsarbeitszeit.“ (S. 397)
Wer eure erste Seite zu den Grundprinzipien liest, muss aber bis dahin verstanden haben, dass der betriebliche Leistungsaufwand pro Produkt in Stunden dessen Abgabewert bestimmt. Das würde dazu führen, dass alle von dem Betrieb mit dem niedrigsten „Preis“ beziehen wollen, wodurch die gesamte Kooperation ad absurdum geführt würde. Der korrigierende Satz auf Seite 397, der für das Verständnis der Grundprinzipien wichtig ist, wird durch den Konjunktiv des vorangehenden Satzes zudem relativiert.
„Außerdem können Betriebe auf diese Weise für Produkte der gleichen Klasse Durchschnittsaufwände berechnen und diese Produkte dann auch zu gemittelten »Kooperativpreisen« abgeben.“
Abgesehen von diesen Unklarheiten bei der Darstellung der Arbeitszeitrechnung hätte ich es gut gefunden, wenn ihr den Unterschied in der Vermittlung über die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit bzw. den Begriff der unmittelbar gesellschaftlichen Arbeit ausführlicher erklärt hättet. Das gilt auch für die lediglich angedeutete Kritik am wichtigen „Unterschied zu kleinbürgerlichen, proudhonistischen Konzepten von Arbeitszeitrechnung“. Schließlich sind sicherlich 90 % der Prokla-Leserschaft Anhänger moderner Varianten dieser Vorstellung (Stichwort „Fairtrade“).
Ich meine den Hinweis darauf, dass in einer Marktwirtschaft der gesellschaftliche Zusammenhang der Arbeit erst hinter dem Rücken der Gesellschaftsmitglieder über die Konkurrenz hergestellt wird, indem produktive Arbeit unproduktive Arbeit entwertet. Wohingegen auf der Grundlage der Arbeitszeitrechnung die individuelle Arbeitszeit unmittelbar gesellschaftlich anerkannt wird, indem jedes Gesellschaftsmitglied, das eine Stunde Arbeit zur Gesellschaft beiträgt, ein Produkt einer Stunde gesellschaftlich durchschnittlicher Arbeit erhält – unabhängig davon, ob seine Effizienz höher oder niedriger als die gesellschaftliche Durchschnittseffizienz ist. Unterschiede in der individuellen Produktivität werden auf der Grundlage der Arbeitszeitrechnung innerhalb der Kooperation im Rahmen der öffentlichen Buchführung ausgeglichen.
Der Unterschied zu kleinbürgerlichen, proudhonistischen Konzepten der Arbeitszeitrechnung bzw. dem Idealismus von Fairtrade-Konzepten besteht darin, dass die Anhänger eines gerechten Tauschhandels mit der Aufhebung der Konkurrenz („wahrer Wert“/„faire Preise“) den einzigen Regulator abschaffen wollen, der in einer Gesellschaft austauschender Warenproduzenten die Gesellschaftsmitglieder über die Be- bzw. Entwertung ihrer Waren mit der Nase darauf stößt, was und wie viel die Gesellschaft braucht oder nicht braucht.
Diese Konzepte zeugen von einem Unverständnis der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise. Genauso wenig, wie sich der Katholizismus durch die Ernennung des „wahren” Papstes abschaffen lässt, lassen sich die Folgen kapitalistischer Warenproduktion durch die Herstellung des „wahren Werts” beseitigen. (ausführlicher in: MEW 20, S. 278ff sowie MEW 4, S. 98ff u. 563ff sowie L.L. Men, Was ist Sozialismus? S. 21ff)
2. Die Rolle der öffentlichen Buchführung
Die wesentliche Aufgabe der Öffentlichen Buchhaltung – die Ermittlung der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit und auf dieser Grundlage die Vorgabe der Verrechnungswerte je Produktgruppe bzw. Produkt – kommt bei euch nicht vor. Ihr gebt als ihre Hauptaufgabe an:
„… bei ihr werden die Produktionspläne der einzelnen Betriebe eingereicht, geprüft und genehmigt.“
Wenn ihr auf die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit zu sprechen kommt, dann nur in dem Sinne, dass die zu Branchenverbänden zusammengeschlossenen Betriebe diese errechnen könnten.
Die Öffentliche Buchhaltung, wie ihr sie beschreibt – „die eingereichten Produktionspläne prüfen und genehmigen“ –, kann ich mir nur als riesige Behörde vorstellen. Soll wirklich jeder betriebliche Plan und damit auch jede unterjährige Plananpassung durch eine übergeordnete Behörde geprüft und genehmigt werden? Wo bleibt da die Selbstverwaltung der Betriebe?
Ich denke, ihr vermischt die betriebliche und die gesellschaftliche Ebene bezüglich der Buchführung. Das zeigt sich auch im folgenden Satz, in dem ihr den Betrieben Vermögenswerte zuschreibt:
„Sollten die Pläne schließlich bewilligt werden, erhalten die Betriebe von der Öffentlichen Buchhaltung das entsprechende Stundenguthaben, um Produktionsmittel und Rohstoffe zu beziehen und ihre Arbeitskräfte vergüten zu können.“
Wie soll das funktionieren? Was macht der Vorlieferant mit dem Stundenguthaben, mit dem er für seine Leistung
bezahlt wird? Bezahlt er damit seine Mitarbeiter und Vorlieferanten? Das wäre ja wie zirkulierendes Giralgeld.
Oder erlischt das Guthaben beim Vorlieferanten? Wofür braucht er es dann?
Auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel kann es keine betrieblichen Vermögenswerte geben.
Wahrscheinlich musstet ihr bei eurer App betriebliche Vermögenswerte verbuchen, da sich die App auf eine
privatwirtschaftliche Verbuchung von Arbeitszeiten bezieht. Bei den „Grundprinzipien“ sind dagegen vergesellschaftete Produktionsmittel unterstellt.
Im Folgenden versuche ich, aus meiner Sicht die Aufgaben der Öffentlichen Buchhaltung und das Verhältnis
zwischen Öffentlicher Buchhaltung und selbstverwalteten Betrieben zu beschreiben, um meine Einwände zu
verdeutlichen.
Am Anfang steht die Registrierung der Betriebe bei der Öffentlichen Buchhaltung. Kommt also ein neuer Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb hinzu, muss er zunächst einen Antrag auf Aufnahme in die öffentliche Buchführung stellen. Dies ähnelt dem Vorgehen im Kapitalismus, bei dem Betriebe ihren Geschäftsplan bei Banken präsentieren, um eine Kreditbewilligung zu erhalten.
Wird die gesellschaftliche Zweckmäßigkeit anerkannt, eröffnet die Öffentliche Buchhaltung in ihrem Hauptbuch einen Buchungskreis für den neuen Betrieb. In diesem werden alle Betriebsvorgänge dezentral vom Betrieb selbst verbucht.
Die Betriebe agieren auf dieser Grundlage – ähnlich wie im Kapitalismus – völlig selbstständig. Sie erstellen jedes
Jahr ihre Betriebspläne, werben entsprechend Mitarbeiter an und knüpfen die erforderlichen Beziehungen zu
ihren Vorlieferanten. Sie produzieren ihre Produkte und liefern diese direkt an die entsprechenden Verteilzentren
bzw. bei direkten Bestellungen an die Endverbraucher.
Die Verrechnung zwischen den Betrieben und ihren Vorlieferanten erfolgt im jeweiligen Buchungskreis des
Hauptbuchs der Öffentlichen Buchhaltung. Die gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeiten pro Produkt werden
hierfür jährlich über die Öffentliche Buchhaltung bzw. die jeweiligen Branchengremien anhand der jährlichen
Betriebspläne oder anhand von Erfahrungswerten festgelegt. Je nach der vom Durchschnitt abweichenden
Produktivität der einzelnen Betriebe ergeben sich über die Arbeitszeitverrechnung Überschüsse und Defizite in
den jeweiligen Buchungskreisen der Betriebe, die sich im Hauptbuch der Öffentlichen Buchhaltung wieder ausgleichen. Es handelt sich allein um eine Verrechnung auf Gesellschaftsebene. Vermögenswerte werden nicht von der Öffentlichen Buchhaltung zu den Betrieben bzw. zwischen den Betrieben verschoben.
Die Betriebe agieren somit unabhängig von der gesellschaftlichen Verrechnung. Sie kontrollieren sich jedoch auf der Grundlage der öffentlichen Buchführung selbstständig. Dabei werden sie von den Gremien der Öffentlichen Buchhaltung unterstützt, die bei fragwürdigen Abweichungen bzw. Defiziten im Sinne der Gemeinschaft mit Rat oder Kritik eingreifen.
Im Extremfall, wenn der gesellschaftliche Nutzen der betrieblichen Tätigkeit in Zweifel gezogen wird, kann die Öffentliche Buchhaltung dem Betrieb die gesellschaftliche Verrechnung verweigern, indem sie den Buchungskreis schließt.
3. Private versus gesellschaftliche Arbeit
Ihr schreibt ganz nebenbei:
„Nichts spricht zum Beispiel dagegen, auch Haushaltsarbeiten in die Arbeitszeitrechnung miteinzubeziehen.“
Dem würde ich widersprechen.
Wenn ich beispielsweise zu Hause auf meine Kinder aufpasse, koche, einkaufen gehe, staubsauge und dafür Arbeitszertifikate bekomme, kann ich dann Produkte aus der „gesellschaftlichen“ Produktion entnehmen? Nein, denn dann würde das Gleichgewicht zwischen notwendigem Arbeitsbeitrag und Konsumentnahme gestört.
Im Sinne der Arbeitszeitrechnung müsste ich mich erst als Betrieb registrieren lassen. Dann könnte ich für das Staubsaugen Arbeitszertifikate erhalten und im gleichen Zug das Staubsaugen als Produkt anbieten. Das wäre bei Arbeiten, deren Ergebnis ich zugleich konsumiere, unsinnig. Wenn ich meinem Partner das Staubsaugen gegen Arbeitszertifikate anbieten würde und er mir im Gegenzug das Abwaschen, wäre das genauso unsinnig.
Ohne eine klare Trennlinie zwischen privater und gesellschaftlicher Arbeit wird die Arbeitszeitrechnung nicht funktionieren. Ich könnte mir folgende Abgrenzung vorstellen: Arbeiten, die man für sich selbst oder im Bekanntenkreis verrichtet, sind privat. Arbeiten, die allgemein für die anonyme Gesellschaft geleistet werden, sind potenziell als gesellschaftliche Arbeit anerkennungsfähig.
In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass die für das kapitalistische Produktionsverhältnis typische geschlechtsspezifische Zuweisung von Haushaltsarbeiten durch die Durchsetzung des „Prinzips der gleichen Stunde“ weitgehend an Bedeutung verlieren wird.
Gesellschaftlich relevante Unterschiede bei Haushaltsarbeiten, wie beispielsweise Altenpflege oder Kinderbetreuung, könnten ähnlich wie Pflegegeld oder Kindergeld im Sinne gesellschaftlicher Transferleistungen über die Kürzung des FIK verrechnet werden. Wollte man dies jedoch generell auf Haushaltsarbeiten anwenden, wäre der FIK negativ. Das würde einem Scheitern der Arbeitszeitrechnung gleichkommen.
4. Öffentliche Güter
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass fast alle, die die Arbeitszeitrechnung als Produktionsverhältnis freier und gleicher Menschen befürworten, diese am liebsten gleich wieder abschaffen wollen, indem sie sie weitgehend durch öffentliche Güter ersetzen.
„Produkte und Dienstleistungen ohne Gegenleistung … Darunter sind zunächst Betriebe zu verstehen, die die Bevölkerung mit Gütern des Grundbedarfs versorgen, wie Wohnung, Heizung, Stromversorgung, Pflege und Gesundheit, Bildung und Erziehung, gegebenenfalls auch Grundnahrungsmittel etc.“
Mit diesem Satz seid ihr dem Modell von Sütterlütti und Meretz sehr nah, obwohl ihr es zurecht kritisiert. Anstelle eines weitgehend direkten Verhältnisses von Produzent und Produkt würden Produktion und Verteilung moralisch über „Solidarität“ oder politisch über übergeordnete Instanzen geregelt werden.
Warum verteidigt ihr die Arbeitszeitrechnung nicht offensiv als nützliches Hilfsmittel? Nur sie ermöglicht es den Gesellschaftsmitgliedern, ihr Produktionsverhältnis selbstständig und rational im Hinblick auf das Verhältnis von gesellschaftlichem Aufwand und Ertrag zu steuern. Es ist widersprüchlich, Freiheit zu fordern, aber zugleich die Realität zu ignorieren. Erst in einer Gesellschaft, in der die Menschen bewusst über ihre Produktionsverhältnisse verfügen, ist Freiheit möglich.
Wenn eine Gesellschaft beispielsweise Wasser oder Strom zum öffentlichen Gut erklärt, dann verschwindet dadurch nicht die notwendige Arbeit für die Wasser- oder Stromversorgung, sondern allein die Transparenz darüber. Dann ist es rational, mit Wasser oder Strom so umzugehen wie mit der Luft zum Atmen. Dann ersetzt die Moral den rationalen, eigenverantwortlichen Umgang durch Appelle zur Sparsamkeit.
Die Befürwortung der Ausweitung öffentlicher Güter anstelle der Arbeitszeitrechnung öffnet Tür und Tor für diejenigen, die Rationierung zum „Wohle der Bevölkerung” gegenüber der Selbstverwaltung propagieren.